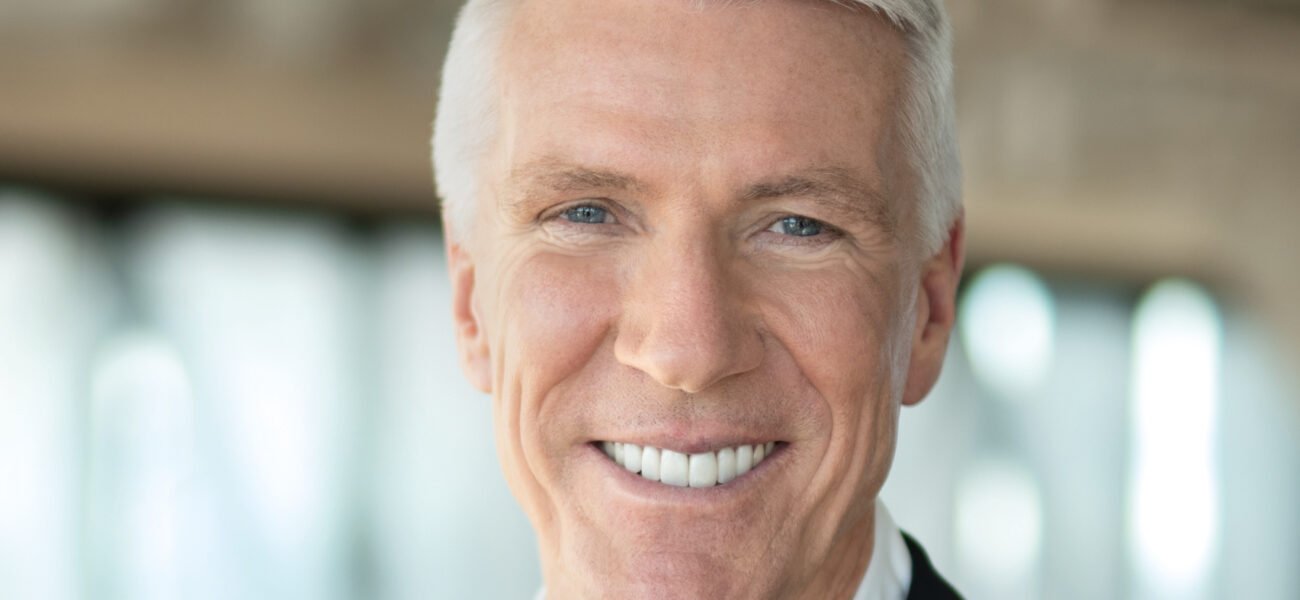Ralf Wintergerst, 61 Jahre, verheiratet, fünf Kinder. Seine Karriere: äußerst eindrucksvoll. Als Chef von Giesecke+Devrient hat der Baldhamer das Münchner Traditionsunternehmen drastisch umgebaut – von einem reinen Banknotenhersteller zum Tech-Konzern. Jüngst erst konnte Wintergerst verkünden, das Ziel von drei Milliarden Euro Umsatz schneller erreicht zu haben, als gedacht. Während sich andere zufrieden zurücklegen würden, kämpft der Frühaufsteher in seiner Funktion als Präsident des wichtigen Digitalverbands Bitkom leidenschaftlich für massive Fortschritte bei der Digitalisierung. Wie man Kämpfe gewinnt, hat der promovierte Betriebswirt schon mehrfach erfolgreich bewiesen. In seiner Jugend war Wintergerst vier Mal deutscher Karatemeister und 1990 sogar Europameister. Wie jemand tickt, der in seiner knappen Freizeit eine Doktorarbeit schreibt – „um sich zu entspannen“, wie er sagt – haben wir uns auch gefragt und den erfolgreichen Top-Manager zum Gespräch getroffen.
Herr Wintergerst, es heißt, Sie seien bestens vernetzt und hätten die Mobilfunknummer von Olaf Scholz. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie mit dem Bundeskanzler telefonieren?
Ralf Wintergerst: Ich habe von einigen hochrangigen Politikern die Telefonnummern. Das stimmt. Eine lustige Begebenheit hatte ich erst vor ein paar Wochen, als der europäische „AI Act“ verabschiedet werden sollte – also ein Vorschlag für eine europäische Verordnung zur künstlichen Intelligenz (KI). Da hatte ich an einem Samstagvormittag eine Nachricht von Wirtschaftsminister Robert Habeck auf meinem Telefon, mit der Frage, ob wir mal kurz telefonieren könnten, weil er noch einen Rat gesucht hatte zum Umgang mit dem AI Act. Und dann stand ich da am Samstagmorgen um 10 Uhr in unserem Garten in Baldham und habe mit Herrn Habeck telefoniert. Meine Frau hat geduscht, meine Kinder haben gespielt und ich habe dem Wirtschaftsminister gesagt, dass ich den „AI Act“ zwar nicht besonders toll finde, ihn aber trotzdem nicht ablehnen würde. Denn bei der Künstlichen Intelligenz braucht es ein einheitliches, europäisches Vorgehen. In der Woche drauf, fand ich dann Dinge, die wir ausgetauscht hatten, so auch tatsächlich im Beschluss wieder. Das fand ich irgendwie nett. Da weiß man, dass man zumindest gehört wird.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Politiker Ratschläge überhaupt annehmen oder sich beratungsresistent in ihrer Blase bewegen.
Ich habe schon Kritikpunkte. Um die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft steht es nicht zum Besten im Moment. Wenn ich das in anderen Ländern sehe, z. B. in den USA: Die streiten sich dort auch wie die Kesselflicker, die US-Regierung geht auch hart mit den Unternehmen um, wenn etwas nicht stimmt, und das ist auch richtig, aber am Schluss steht man zur Wirtschaft. Und das Gefühl hat man in Deutschland gerade nicht. Das ist schwierig.
Woran machen Sie das fest?
Alleine die Regulierung ist zu einem riesigen Ballast geworden für die Unternehmen. Ich kann das konkret für Giesecke+Devrient sagen: Vor zehn Jahren hatten wir eine Buchhaltungsabteilung, die die Steuern mitgemacht hat. Heute haben wir eine eigene Steuerabteilung mit zehn Leuten, nur in Deutschland, nur für Fachsteuerfragen. Wir mussten nur für administrative Themen, die keinen Mehrwert für den Kunden haben, massiv aufstocken in den vergangenen Jahren. Das ist aber nicht nur ein Problem in Deutschland, das gibt es auch in anderen Ländern. Aber die derzeitige Regierung ist schon etwas wirtschaftsfern.
Wäre es für Sie eine Option, in die Politik zu wechseln?
Nö, ich weiß auch nicht, ob ich das kann. Die Funktionsmechanismen in der Politik sind ja ganz anders. Ich komme aus dem Leistungssport und auch im Unternehmen gilt es etwas zu schaffen, etwas vorwärts zu bringen, wettbewerbsfähig zu werden und zu bleiben. Die Erfolgsfaktoren sind den Umsatz zu steigern, Gewinn zu machen, die Mitarbeiter gut zu behandeln und zu versorgen, Arbeitsplätze für die Zukunft zu schaffen. Das kann ich. In der Politik geht es oft eher darum zu fragen, was kann ich in meiner Amtszeit machen, um wieder gewählt zu werden. Ich weiß nicht, ob das mein Muster wäre. Wir haben aber auch gute Politiker bei uns, es wäre nur schön, wenn die sich besser vertragen würden. Die Verständigung ist gerade eher schwierig.
Sie haben den Leistungssport angesprochen. Ist Karate noch ein Thema für Sie?
Bis zum Ende meines Studiums und während meiner ersten Jobs habe ich es immer noch gemacht, hab dann auch als Trainer gearbeitet. Aber irgendwann war ich so viel unterwegs, da ist man nicht mehr zuverlässig und dann ging das nicht mehr. Was ich aber immer noch mache, sind meine Karate-Übungen und mein Fitness-Training – sonst geht das auch nicht mit dem Gewicht.
Warum eigentlich Karate und nicht der Klassiker: Fußball?
Ich komme vom Niederrhein, Richtung Venlo bei der niederländischen Grenze. Mein Stadion war das von Borussia Mönchengladbach und da habe ich auch Jupp Heynckes noch live spielen sehen. Damals hatte ich so lange Haare wie Günter Netzer und habe natürlich auch Fußball gespielt – im vorderen Mittelfeld. Früher gab es bei uns am Ort noch kein großes Sportangebot. Aber irgendwann habe ich den Kampfsport entdeckt. Ich fand das cool. Und dann ging das relativ schnell – ich war groß, ich war eher schnell – das hat geholfen und so ging das dann immer weiter. Ich bin da reingerutscht.
Sie haben mehrere Masterabschlüsse in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und jüngst erst an der LMU promoviert. Thema Ihrer Doktorarbeit: „Corporate Governance und Ethik. Unternehmensführung im Anschluss an Immanuel Kant“. Sagen Sie jetzt nicht, dass Sie da auch nur „reingerutscht“ sind?
Das hat sich entwickelt, weil ich das nebenberufliche Lernen nie aufgehört habe. Ich brauche das, um mich zu entspannen. Corona hat geholfen, da war ich immer zuhause. Und da ich ein Frühaufsteher bin, habe ich morgens von 5 bis 7 Uhr geschrieben, dann gearbeitet und abends noch ein bisschen weitergeschrieben. Die Doktorarbeit ist relativ zügig fertig gewesen. Das hat Spaß gemacht.

Sie sind äußerst diszipliniert, sonst wäre so eine Lebensleistung wohl auch nicht zu schaffen. Können Sie auch mal locker lassen, einfach nur am Strand liegen und ein Buch lesen?
Ich war mit meiner Tochter letztens im Deutschen Museum, da gibt es ein Lab von der Technischen Universität und sie war bei einem Roboterkurs dabei, wir waren da zusammen. Das ist für mich Freizeit. Mit der Familie Dinge zu unternehmen, ein paar Tage nach Österreich fahren. Das ist dann bei mir gar nichts tun. Und ich lese sehr gerne und viel.
Seit dem 1. April dürften Sie auch kiffen.
Dazu kann und möchte ich gar nichts sagen. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht, deshalb habe ich dazu keinerlei Bezug und habe mich auch mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt. Aber was anderes zum Gesundheitsministerium: Minister Lauterbach und seine Behörde treiben gerade massiv die Digitalisierung voran. Im Gesundheitswesen gibt es auch großes Potential. Ich kriege immer die Krise, wenn ich beim Arzt ein Aufnahmeprotokoll ausfüllen muss – obwohl ich das schon fünf Mal gemacht habe. Und dann gibt es noch Faxgeräte. Das geht einfach nicht mehr in einem Land, das den Anspruch hat, vorne mitzuspielen.
Wo stehen wir grundsätzlich bei der Digitalisierung?
Deutschland hinkt deutlich hinterher, wir müssen endlich Gas geben. Das predige ich als Bitkom-Präsident täglich: Verwaltungsdigitalisierung muss massiv aufholen. Das ist die einzige Chance, zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Akten hin- und herschieben ist nicht mehr zeitgemäß und vor allem, wenn wir den demografischen Wandel in Deutschland sehen, dann haben wir die Leute, die so etwas machen, auch bald nicht mehr. Wir müssen dringend digitalisieren. Das setzt dann auch die Gelder frei, die wir brauchen, um in Innovationen zu investieren.
Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung ist überschrieben mit dem Motto: „Mehr Fortschritt wagen“. Das klingt nach Wagnis, eher nach Bedrohung, weniger nach mutiger Entschlossenheit.
Wir müssen das dreigeteilt sehen: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die digitale Strategie und der Koalitionsvertrag gehen in die richtige Richtung. Wenn man aber auf die Umsetzung schaut, und das haben wir als Bitkom mit einer Forschungsstudie gemacht, dann wurde von 334 Maßnahmen mit 60 noch gar nicht angefangen, nur etwa 25 Prozent wurden umgesetzt und der Rest ist noch in Umarbeitung.
Es sind natürlich auch viele große Themen dabei, aber die Vehemenz und das Geld fehlen. Nur ein Beispiel: Der Digitalpakt 2.0, also die Digitalisierung der Schulen, wird aus Budgetgründen nicht weitergeführt. Jetzt wissen die Schulen und auch die Länder nicht mehr, wie das finanziert werden soll. Während Corona gab es eine Erstausstattung, aber das ist nur der Anfang und muss dringend fortgeführt werden.
Der zweite Punkt ist – und da muss man auch Kritik an der Wirtschaft üben: Die Unternehmen müssen mehr in Digitalisierung und digitale Produkte investieren, sonst fallen wir im Weltmarkt zurück.
Der dritte Aspekt, und der sollte uns alle skeptisch machen: Es gibt mittlerweile eine Verschlossenheit gegenüber neuen Technologien. Alles wird schlecht gesehen und geredet – Künstliche Intelligenz, Robotic oder automatisiertes Fahren. Nur: Wenn wir nicht Technologie offen sind, dann sind wir weltweit gesehen bald eine digitale Kolonie. Wollen wir das sein? Wir sind schon fast eine, wenn wir nicht mehr investieren. Immer nur auf die Politik zeigen, ist keine Lösung – Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sind alle gefragt. Auch die Medien spielen eine Rolle: Geschichten wie „KI ist gefährlich“ werden gelesen. Das muss man knacken, ich weiß allerdings auch nicht wie. Aber wer immer nur den gleichen Käse macht, kommt nicht vorwärts.

Aber wird die KI nicht Arbeitsplätze kosten?
KI selbst braucht Experten, die sie u.a. programmieren. Wir werden also erst einmal Jobs aufbauen müssen. Natürlich verschieben sich die Jobs in Richtung IT. Manche fallen weg, dafür entstehen neue. Deshalb ist es auch so wichtig in Bildung zu investieren, denn die Fähigkeiten, die man dafür mitbringen muss, verändern sich massiv. Aber das ist eigentlich cool – wenn wir die Chance nutzen.
Was sagen Sie zu der Forderung nach einer 4-Tage-Woche bei gleichem Lohn?
Ich weiß nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner für Work-Life-Balance bin. Unsere Wettbewerbsfähigkeit steht auf dem Spiel und dafür muss man arbeiten – nicht 4 Tage, sondern 5 oder vielleicht sogar 5,5 Tage. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel: Wir haben in Malaysia ein Werk. Da sind die Leute sauer, wenn wir mal eine Samstagsschicht streichen. Die wollen sechs Tage arbeiten, damit sie die Kohle mitnehmen können. Und in Deutschland muss man verhandeln, ob man überhaupt fünf Tage durcharbeiten darf. Statt über Work-Life-Balance, sollten wir viel mehr über Work-Life-Integration sprechen, also wie Arbeit und Privatleben sinnvoll miteinander verbunden werden können. Aktuell spürt man hierzulande nicht überall den größten Leistungsansatz. Aber wenn wir nicht genug tun, geht unser Wohlstand in andere Länder. Wir brauchen wieder mehr Kampfbereitschaft, mehr Investitionen. Und wir sollten uns in Deutschland weniger mit uns selbst beschäftigen, sondern den Wettbewerb als das betrachten, was er ist: global.
Herr Wintergerst, vielen Dank für das Gespräch.
Bürgerstiftung Vaterstetten unter Vorsitz von Ralf Wintergerst
Nach dem Vorbild der 2010 in der Nachbargemeinde Haar gegründeten Bürgerstiftung soll es künftig in Vaterstetten ein ähnliches Angebot geben. Derzeit befindet sich die Bürgerstiftung in der Gründung. Sinn und Zweck ist es, Gelder – etwa durch Spenden oder Erbschaften – einzusammeln und anschließend für soziale und karitative Zwecke einzusetzen, für die die Gemeinde kein Geld hat. Ausdrücklich nicht Ziel der Stiftung ist es, Haushaltsmittel der Gemeinde zu ersetzen.
Zwar bekommt die Gemeinde schon jetzt die eine oder andere Erbschaft. Für diese Möglichkeit darf die Kommune, anders als die Stiftung, jedoch keine Werbung machen. In der CSU, auf deren Initiative das Projekt zurückgeht, geht man davon aus, dass mit der Einrichtung der Stiftung und der damit einhergehenden Publizität eine wesentlich größere Bereitschaft entsteht, das örtliche Gemeinwesen mit Privatvermögen zu unterstützen.
Eine Personalie steht bereits fest: Ralf Wintergerst wird den Vorsitz des Stiftungsvorstands übernehmen – selbstverständlich ehrenamtlich. „Die Stiftung dient dem Gemeinwohl und ich finde es schön etwas fürs Gemeinwohl zu tun. Und zwar in der Umgebung, in der ich wohne“, so der 61-Jährige gegenüber B304.de. Mit der Stiftung werde eine Brücke gebaut zwischen den Projekten, die sich eine Gemeinde leisten kann und muss, und den Dingen, die sie sich nicht leisten kann. „Dazu einen kleinen Beitrag leisten zu können, finde ich erstrebenswert.“